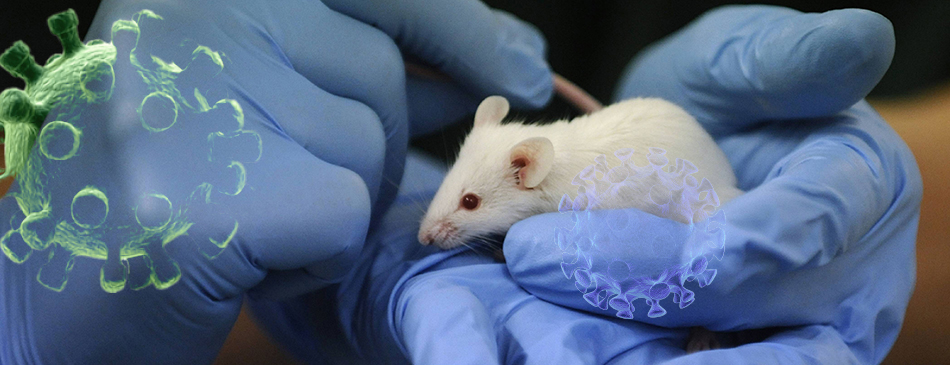
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Bundesrat am 16. April 2020 auf Vorschlag des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) das Nationale Forschungsprogramm «Covid-19» (NFP Covid-19) lanciert, um dem dringenden Forschungsbedarf zu möglichen Behandlungen und zu den Auswirkungen des Virus nachzukommen. Dafür stellt der Bund insgesamt 20 Millionen Franken über zwei Jahre bereit.
Der SNF wurde damit beauftragt, die Leitungsgruppe des NFP einzurichten sowie die Begutachtung und die Auswahl der Forschungsgesuche durch die Expertinnen und Experten zu organisieren. Dabei sollten «möglichst rasch Ergebnisse erzielt» werden. Nach der ersten Ausschreibung gingen 190 Gesuche ein, wie der SNF am 10. Juni 2020 vermeldete. 28 dieser Projekte wurden im August 2020 zur Förderung ausgewählt.
Im Winter 2020 befanden sich bereits mehrere von Pharmaunternehmen entwickelte Impfstoffe in der klinischen Phase, einige waren schon in mehreren Ländern für die Impfung der Bevölkerung zugelassen. Wie war der Stand der universitären Forschungsprojekte des NFP zu jenem Zeitpunkt?
![]()
Am 4. Februar 2021 waren alle 28 Projekte noch am Laufen. Einige waren durch die in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse bereits völlig überholt. Fünf Projekte setzen offiziell Tierversuche ein – zum Beispiel das mit 1’951’700 Franken finanzierte Projekt der Universitätsklinik für Angiologie des Inselspitals und der Universität Bern, das darauf abzielt, die Zusammenhänge zwischen kardiovaskulären Erkrankungen und Covid-19 zu verstehen. Gemäss den Forschenden ist es für die Entwicklung neuer Therapien «entscheidend, zu wissen, welche Zellen mit SARS-CoV-2 direkt infiziert werden können». Dafür untersuchen sie zunächst die entzündliche Immunantwort und die vom Virus verursachten Veränderungen von infizierten Endothelzellen und anschliessend die Auswirkungen einer Infektion an Zebrafischen und Mäusen. Das Ziel des Projekts ist, therapeutische Ansatzpunkte zu finden, die zu einer besseren Behandlung der Covid-19-Erkrankung und zur Verhinderung von Langzeitfolgen im Herz-Kreislauf- oder Nervensystem führen.

Ein weiteres Beispiel ist das mit 597’600 Franken dotierte Projekt, für welches das Departement Medizin des Universitätsspitals des Kantons Waadt (CHUV) verantwortlich zeichnet. Bei diesem Projekt wird das sogenannte STING-Gen bei Mäusen gehemmt. Damit soll das therapeutische Potenzial einer solchen Hemmung für die Verminderung der Entzündungsreaktion bei einer SARS-CoV-2-Infektion untersucht werden.

Das mit 1’189’457 Franken geförderte Projekt des Instituts für Virologie und Immunologie der Universität Bern will das SARS-CoV-2-Genom umkodieren, um abgeschwächte Viren für Impfstoffe zu produzieren. Diese sollen zur Beurteilung «der Sicherheit und der Immunogenität in mehreren Tiermodellen» getestet werden. Die Forschenden wollen damit einen «Beitrag zur weltweiten Entwicklung von SARS-CoV-2-Impfstoffen» leisten.

Das Projekt der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich, das mit 267’016 Franken unterstützt wird, zielt darauf ab, an Mäusen einen mRNA-Impfstoff zu entwickeln, der einfacher hergestellt werden könnte als die bereits entwickelten Impfstoffe der Unternehmen BioNTech, CureVac und Moderna.

Auch das Virologische Institut der Universität Zürich will mit seinem mit 491’681 Franken geförderten Projekt einen Impfstoff entwickeln, obwohl sich, wie die Forschenden selbst schreiben, bereits 42 Impfstoffe in der klinischen Phase (d. h. im Test an freiwilligen menschlichen Probanden oder Patienten) befinden. Anders als die anderen Forschungsteams wollen die Forschenden in Zürich aber ein Darmbakterium (Bacillus subtilis) als Vektor für die Impfung von Mäusen nutzen.
Wer will bis 2022 auf eine Impfung warten?
Welche Erkenntnisse bringen diese Projekte und insbesondere jene Studien, die auf die Entwicklung eines Impfstoffs bis 2022 abzielen? Mittlerweile hat der Bund, wie er am 3. Februar 2021 bekanntgab, bereits drei weitere Lieferverträge zur Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Covid-19-Impfstoffen unterzeichnet.
Die mit der Pandemie verbundene Angst hat die staatlichen Fördergelder sprudeln lassen. Die Projekte der Schweizer Hochschulen, die im Allgemeinen auf die Grundlagenforschung ausgerichtet sind, scheinen jedoch zu langsam und zu schwerfällig, um im Wettlauf um schnelle, der menschlichen Gesundheit dienliche Ergebnisse Schritt halten zu können. Wer an einer ganzen Kohorte von Tieren die immer gleichen langsamen und ineffektiven Versuche wiederholen will, kann damit keine neuen Erkenntnisse gewinnen, die wirklich im Dienste der Bevölkerung stehen. Und das ist ziemlich paradox, denn es ist letztlich die Bevölkerung, die diese überholten Studien bezahlt.
 Die Zahl der Tierversuche an Schweizer Hochschulen nimmt stetig zu
Die Zahl der Tierversuche an Schweizer Hochschulen nimmt stetig zu
Im Jahr 1983, als die erste Schweizer Tierversuchsstatistik veröffentlicht wurde, und noch viele Jahre danach wurden die meisten Tierversuche von Pharmaunternehmen durchgeführt. Dies änderte sich 2012, als erstmals mehr Tierversuche an Schweizer Hochschulen als in Unternehmen durchgeführt wurden. Seither hat die Zahl der Tierversuche an den Hochschulen stetig zugenommen. Seit 2015 führen die Hochschulen sogar doppelt so viele Tierversuche wie die Pharmaunternehmen durch. Diese Entwicklung ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass Tierversuche in Länder verlagert werden, die über weniger strenge oder gar keine Tierschutzgesetze verfügen. Ein Grund ist, dass die von der öffentlichen Hand finanzierten Versuchstierhaltungen grösser und zahlreicher geworden sind und dass immer mehr staatliche Fördergelder in die universitäre Forschung fliessen. Und welche konkreten Ergebnisse für die öffentliche Gesundheit hat uns das gebracht?


